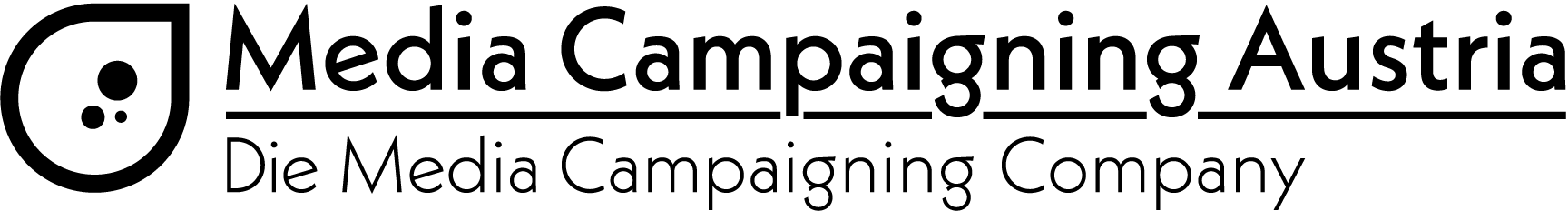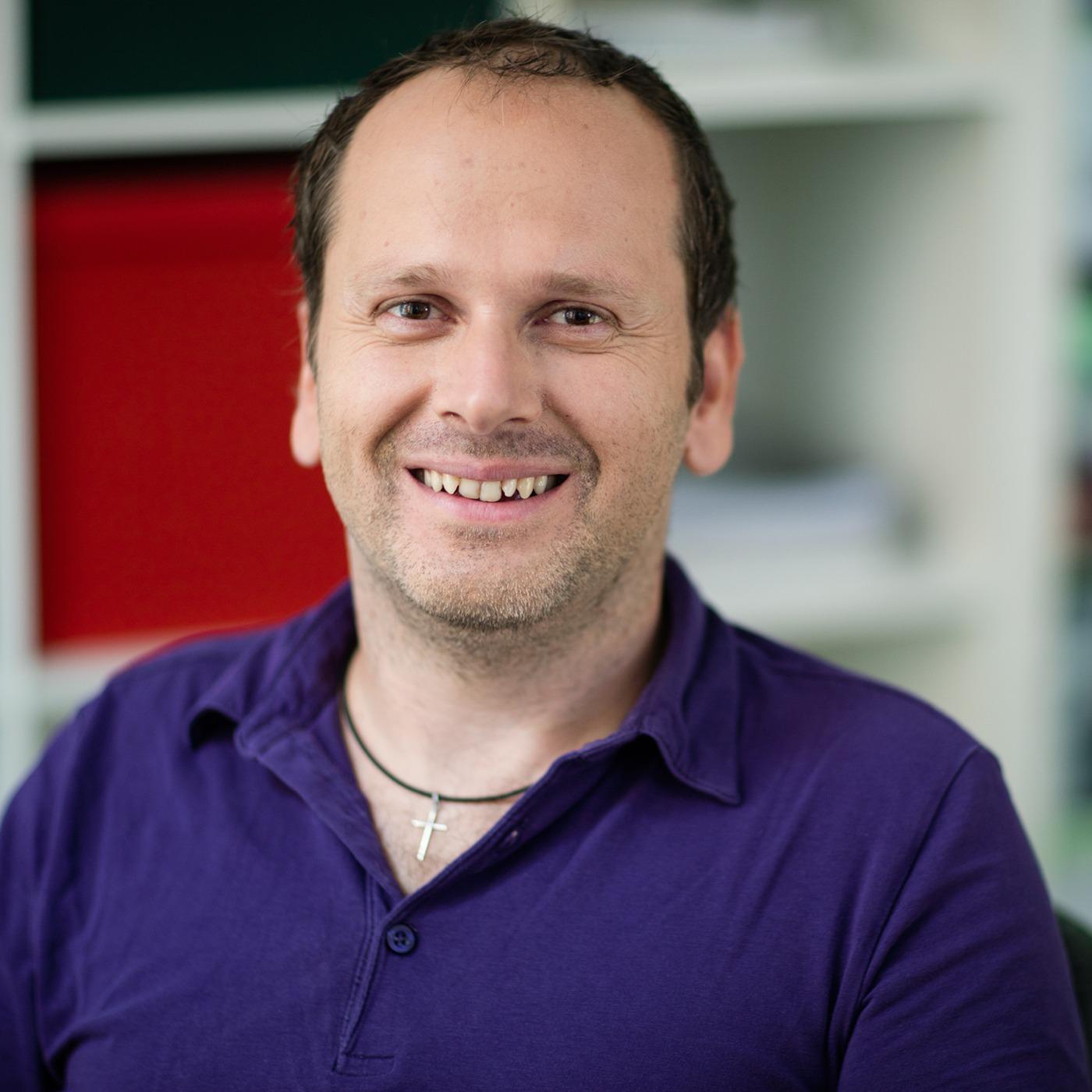Wie verändert künstliche Intelligenz den Journalismus – und was darf sie nicht verändern?
Ich habe mit Clemens Ganner, Chief Operating Officer der APA-Gruppe und Geschäftsführer der APA-Comm, über die Zukunft von Medien, Technologie und Kommunikation gesprochen. Das Gespräch zeigt eindrucksvoll: Der digitale Wandel ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein permanenter Zustand – und Kommunikation ist sein Steuerungsinstrument.
1. KI als Werkzeug, nicht als Wahrheit
Die APA zählt zu den ersten Medienhäusern, die sich klare Leitlinien für den Umgang mit KI gegeben haben. Unter dem Titel „Trusted AI“ hat sie ein Regelwerk etabliert, das Innovation mit Verantwortung verbindet.
Für Ganner steht fest: Technologie darf nie das Vertrauen in Medien untergraben.
KI soll journalistische Arbeit unterstützen – durch automatisierte Zusammenfassungen, semantische Suche, Textprüfung und Metadatenanalyse – aber nicht ersetzen. „Wir müssen verstehen, was Maschinen wirklich können, und wo menschliche Urteilskraft unverzichtbar bleibt“, so Ganner.
Das Ziel ist nicht Effizienz um jeden Preis, sondern algorithmische Souveränität: die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, welche Modelle, Daten und Systeme eingesetzt werden. Damit wird KI zum Werkzeug für Qualität – nicht zum Selbstzweck.
2. Vertrauen als Währung des Journalismus
Ganner beschreibt Vertrauen als das zentrale Kapital moderner Medienorganisationen. Ohne Vertrauen gebe es keine Glaubwürdigkeit – und ohne Glaubwürdigkeit keine Demokratie.
„Alles, was wir mit KI tun, passiert unter dem Dach von Vertrauen und Transparenz.“
Dieses Prinzip zieht sich durch die gesamte Organisation: von der Trennung zwischen Redaktion und PR über transparente Kennzeichnung von KI-Inhalten bis hin zu messbaren Qualitätsstandards. Kommunikation bedeutet für ihn Verantwortung übernehmen – gegenüber Eigentümern, Mitarbeitenden und der Gesellschaft.
3. Kommunikation als Organisationsprinzip
Was Ganner besonders stark betont: Kommunikation ist keine Begleitfunktion, sondern das Betriebssystem moderner Organisationen.
In der APA wirken drei Bereiche zusammen – Redaktion, Technologie und PR – und bilden ein integriertes Kommunikationsökosystem. So entstehen Synergien, die Innovation ermöglichen, ohne den Kern journalistischer Integrität zu gefährden.
Diese Haltung macht deutlich, dass Change-Kommunikation kein isoliertes Projekt ist, sondern ein Dauerzustand. Veränderung wird erst steuerbar, wenn sie kommunikativ strukturiert, gemessen und verstanden wird.
4. Zuhören als Führungsqualität
Ein weiteres Kernthema Ganners ist das strategische Zuhören. Medienbeobachtung und Monitoring sind für ihn keine bloße Datensammlung, sondern Formen institutionalisierter Aufmerksamkeit.
Wer Wandel gestalten will, muss zuerst verstehen, was in seinem Umfeld passiert – in Medien, Politik und Gesellschaft.
Für Ganner bedeutet Zuhören aber auch Empathie: „Verständnis für das Gegenüber zu entwickeln – das ist vielleicht die wichtigste kommunikative Kompetenz unserer Zeit.“
5. Messen heißt verstehen
Wirkung zu messen ist für ihn kein Kontrollinstrument, sondern eine Frage der Ehrlichkeit. Kommunikation, die behauptet, etwas zu verändern, müsse auch belegen können, dass sie es tut.
Er fordert ein stärkeres Bewusstsein für Evaluation, Datenkompetenz und Wirkungsmessung – besonders im Kommunikations- und Campaigning-Bereich. Nur so könne man aus Kommunikation lernen und sie kontinuierlich verbessern.
6. Medien im Wandel – Verantwortung bleibt
Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen – vom Rückgang der Werbeeinnahmen über verändertes Nutzungsverhalten bis zur Dominanz der Plattformen – bleibt Ganner optimistisch. Er sieht die APA als Stütze des österreichischen Mediensystems, deren Aufgabe es ist, journalistische Unabhängigkeit zu sichern und gleichzeitig Kommunikationsprofis mit Daten, Tools und Wissen zu unterstützen.
Seine Vision: Eine Medienlandschaft, in der Technologie, Ethik und Dialog kein Widerspruch sind, sondern ein Dreiklang.
Mehr spannende Interviews finden sich im Archiv.