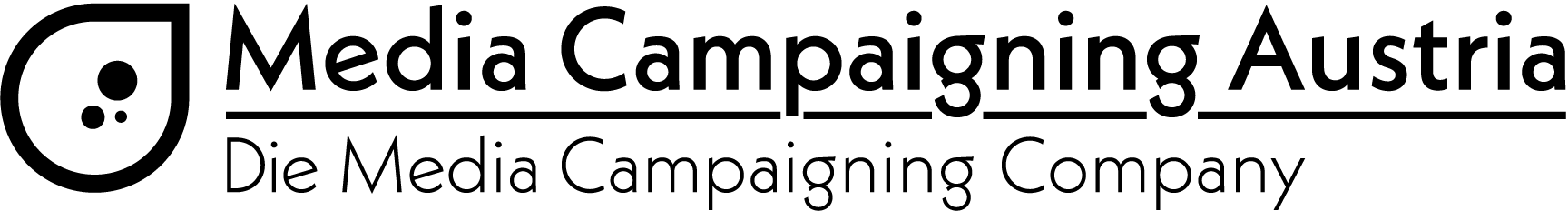Politische Kommunikation ist heute laut, schnell und oft gnadenlos emotional. Aber wann wirkt sie wirklich? Und wann kippt sie in reine Inszenierung? Darüber spricht SPÖ-Nationalratsabgeordnete Julia Herr in der neuen Folge von „Beyond the Edge – dem Media-Campaigning-Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen“, moderiert von Martin Aschauer.
Herr macht in diesem Gespräch klar: Veränderung beginnt nicht in einer Agentur, nicht in einem Slogan und nicht in einem Logo. Veränderung beginnt bei Haltung.
Wer ist Julia Herr?
Julia Herr ist Abgeordnete zum Nationalrat (SPÖ). Sie sieht Politik als Auftrag, Mehrheiten zu organisieren – und zwar für konkrete Verbesserungen im Alltag der Menschen. Nicht Show, sondern Wirkung.
„Der Nationalrat beschließt in Österreich die Gesetze. Unsere Aufgabe ist es, Mehrheiten für Veränderungen zu finden, die möglichst vielen Menschen helfen“, sagt sie.
Damit ist sie sofort mitten im Kern dessen, worum es in der Episode geht: Wie kommuniziert man Veränderung so, dass Menschen sie glauben – und sich anschließen?
Was macht gute politische Kommunikation aus?
Für Julia Herr gibt es einen einfachen, aber harten Prüfstein: Glaubwürdigkeit.
„Politische Kommunikation funktioniert dann gut, wenn das, was du inhaltlich willst, und das, wie du es sagst, wirklich zusammenpasst.“
Das heißt:
- Keine künstliche Inszenierung.
- Keine leeren Versprechen.
- Keine Haltung, die nur gespielt ist.
Sie warnt ausdrücklich davor, Politik auf Styling, Grafik und Formate zu reduzieren. Ob eine Politikerin eine schöne Schriftart in einer Instagram-Story verwendet, ist zweitrangig. Entscheidend ist, ob die Person wirklich für das steht, was sie sagt.
Oder, in ihren Worten:
„Gute politische Kommunikation ist kein Handwerk, das man einfach lernen kann. Sie ist Haltung.“

Emotion ist mächtig – und gefährlich
Herr sagt sehr klar: Fakten allein reichen nicht. Kommunikation funktioniert nur, wenn sie Menschen emotional berührt. Das ist Voraussetzung für politische Mobilisierung.
Aber sie macht auch etwas, das in der aktuellen politischen Kommunikation selten geworden ist: Sie benennt das Risiko.
„Aktuell ist politische Kommunikation vor allem von Emotionen getrieben. Das ist verständlich – aber auch gefährlich.“
Warum gefährlich?
Weil Emotion ohne Substanz sehr schnell zur reinen Projektionsfläche wird. Herr nennt als Beispiel Wahlkämpfe, die nur das Gefühl von „Zeit für Veränderung“ versprechen – ohne zu erklären, welche Veränderung konkret gemeint ist. Das erzeugt kurzfristig Hoffnung, aber langfristig Enttäuschung und Vertrauensverlust.
Damit setzt sie einen klaren Gegenpunkt zur reinen Emotionalisierung: Emotion muss glaubwürdig sein. Sie muss von echter Überzeugung getragen sein. Sonst kippt sie in Manipulation.
„Ich bin Teil der SPÖ, weil ich mich in die Idee der Arbeiter:innenbewegung verliebt habe“
Was sie antreibt, ist nicht Taktik, sondern ein Wert: Gerechtigkeit.
Julia Herr beschreibt sehr persönlich, warum sie überhaupt in die Politik gegangen ist. Nicht wegen Karriere. Sondern wegen Ungerechtigkeit.
Sie erzählt von Fragen, die sie mit 15 umgetrieben haben:
- Warum sind manche Kinder arm und andere reich?
- Warum gibt es in einem Land wie Österreich überhaupt Obdachlosigkeit?
- Warum werden Mädchen anders behandelt als Burschen?
Daraus wurde etwas Grundsätzliches: der Glaube an die Kraft des Kollektivs.
„Ich bin Teil der SPÖ, weil ich mich in diese Bewegung verliebt habe. Menschen, die wenig Macht haben, können gemeinsam Großes schaffen.“
Das ist klassische politische Narrative-Arbeit: „Gemeinsam schaffen wir es.“ Aber bei ihr kommt das nicht als Kampagnenfloskel, sondern als identitätsbildendes Motiv. Das ist Storytelling, aber nicht erfundenes Storytelling.
„Politik darf ihre Haltung nicht outsourcen“
Ein sehr klarer, sehr starker Teil der Folge: Herr ist skeptisch, wenn Parteien Kommunikation an Agenturen, Public-Affairs-Firmen oder externe Strategen auslagern.
Warum?
Weil damit nicht nur Kampagnenplanung ausgelagert wird – sondern im Zweifelsfall auch die Haltung.
„Im besten Fall weiß eine Partei oder eine Politikerin selbst, wofür sie steht, was sie verändern will, welche Worte sie wählt. Das sollte man sich nicht von einer Agentur vorschreiben lassen.“
Das ist mehr als Medienkritik. Das ist ein Angriff auf den Trend zur politischen Professionalisierung ohne Substanz: Politik als Produkt, statt Politik als Verantwortung.
Klimapolitik: Nicht moralisieren – Mehrheiten gewinnen
Herr ist Klima- und Umweltsprecherin. Und sie kritisiert eine bestimmte Art von Klimakommunikation sehr deutlich: die moralisierende Lifestyle-Debatte.
Also: „Iss dieses, kauf jenes nicht, flieg weniger, fahr anders, sei besser.“
Sie hält das für politisch gefährlich.
Warum?
- Weil sich Menschen moralisch bewertet fühlen („die Guten vs. die Schlechten“).
- Weil es schnell in ein Gefühl von Schuld kippt.
- Weil es Menschen ausschließt, statt sie mitzunehmen – gerade jene, die man für Veränderung braucht.
„Wir werden Klimaneutralität nur schaffen, wenn die Mehrheit mitgeht. Und diese Mehrheit holst du nicht über moralische Belehrung.“
Stattdessen fordert sie:
- Strukturelle Lösungen (z. B. leistbare Energiepreise, Klimagesetz, klare Regeln).
- Soziale Gerechtigkeit im Klimaschutz (wer wenig hat, darf nicht die ganze Last tragen).
- Systemische Antworten statt individueller Schuldzuweisung.
Das ist kommunikativ stark, weil sie Klimapolitik als Gerechtigkeitsfrage rahmt – nicht als Lifestylefrage.
„Nicht du bist das Problem. Das System ist es.“
Einer der zentralsten Sätze des Gesprächs ist eigentlich ein Angebot an die Menschen.
Viele erleben Druck: Geld, Miete, Energiepreise, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Stress im Job. Viele haben das Gefühl, sie schaffen es nicht.
Herr dreht an dieser Stelle den Frame um.
„Ich möchte Menschen sagen: Du bist nicht das Problem. Das System ist das Problem.“
Das ist politisch, aber auch psychologisch. Sie nimmt Schuld und individuelle Überforderung raus – und ersetzt sie durch kollektive Handlungsfähigkeit. Das ist strategisches Framing: weg von „Ich bin schuld, dass ich nicht alles schaffe“ – hin zu „Das ist politisch veränderbar“.
Genau hier wird politische Kommunikation zu Change-Kommunikation.
Über 40 weitere spannende Interviews finden sich im Archiv.
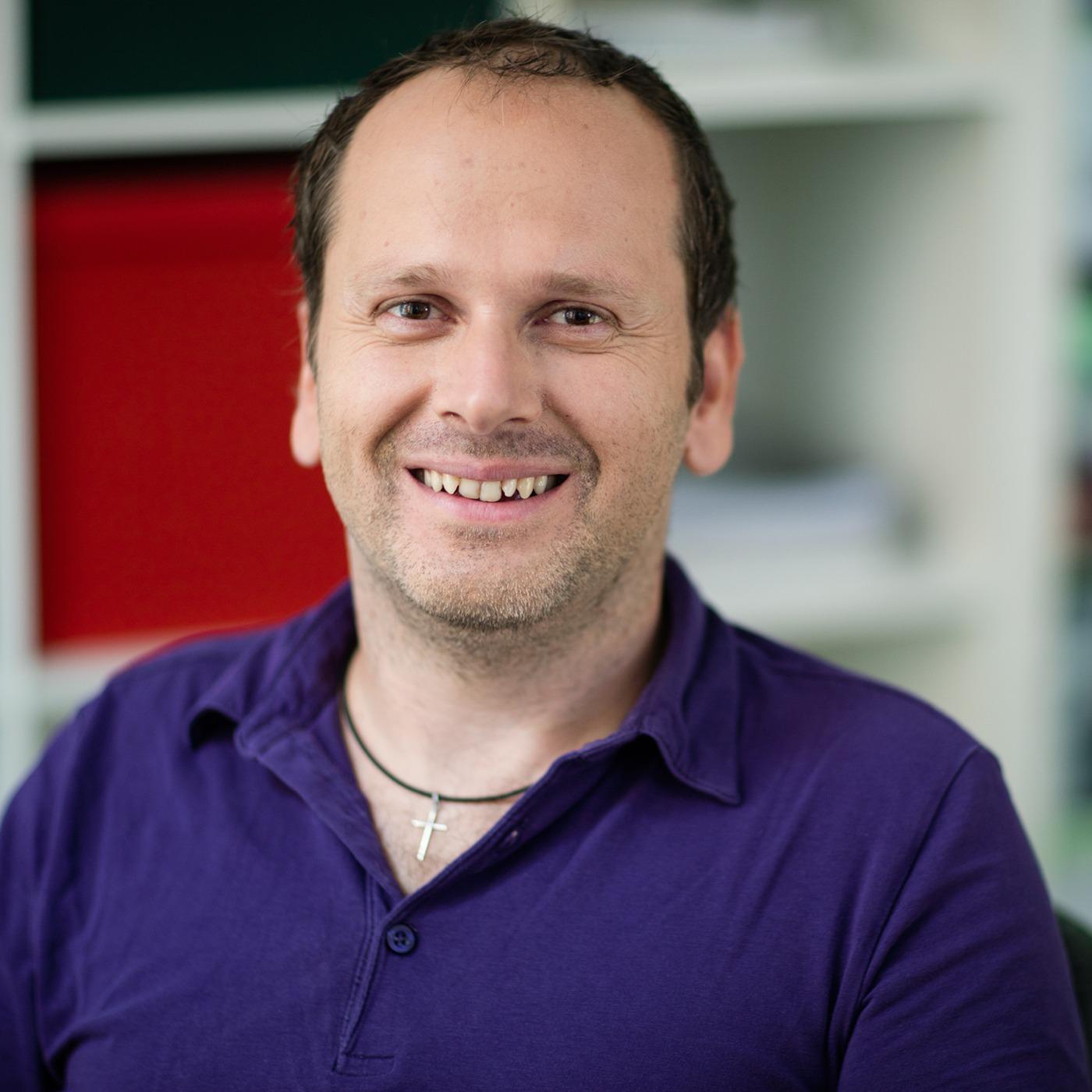
Beyond the Edge ist der erste Media-Campaigning-Podcast im deutschen Sprachraum. Es ist der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Im Podcast „Beyond the Edge“ spricht Media-Campaigner Martin Aschauer mit seinen Gästen über Visionen und Geschichten von morgen. Inspiriert von Podcasts wie „Erklär mir die Welt“, „Frühstück bei mir“ oder „Gemeinsam besser“ werden intim und persönlich die Geheimnisse, der Heldinnen und Helden sowie Expertinnen und Experten die Menschen inspirieren Großes zu leisten, gelüftet. Mehr erfahren unter https://mediacampaigning.net
Zukunftsforscher Tristan Horx erklärt, warum sich unsere Kommunikationswelt gerade grundlegend neu ordnet. Lineare Medien ziehen sich in eine Nische zurück, während soziale Plattformen längst kein echtes Sender-zu-Sender-System mehr sind – Algorithmen entscheiden, welche Stimmen sichtbar werden. Das verändert nicht nur Kampagnen und Journalismus, sondern auch unser Bild von Zukunft und Wandel. In dieser Folge spricht Tristan darüber, wie Algorithmen unsere Aufmerksamkeit steuern und „Ragebait“ systematisch belohnen, warum klassische Dramaturgie wie die Heldenreise an Wirkung verlieren und wieso positive Zukunftsbilder heute fast ein rebellischer Akt sind.